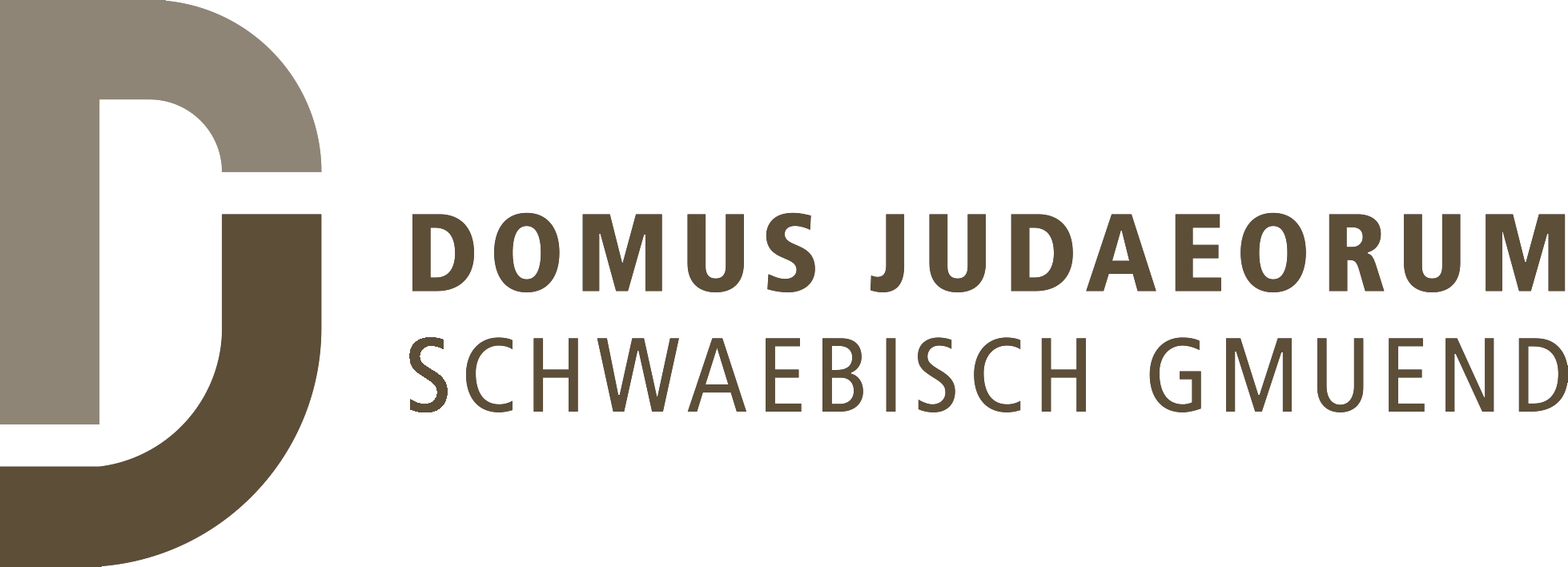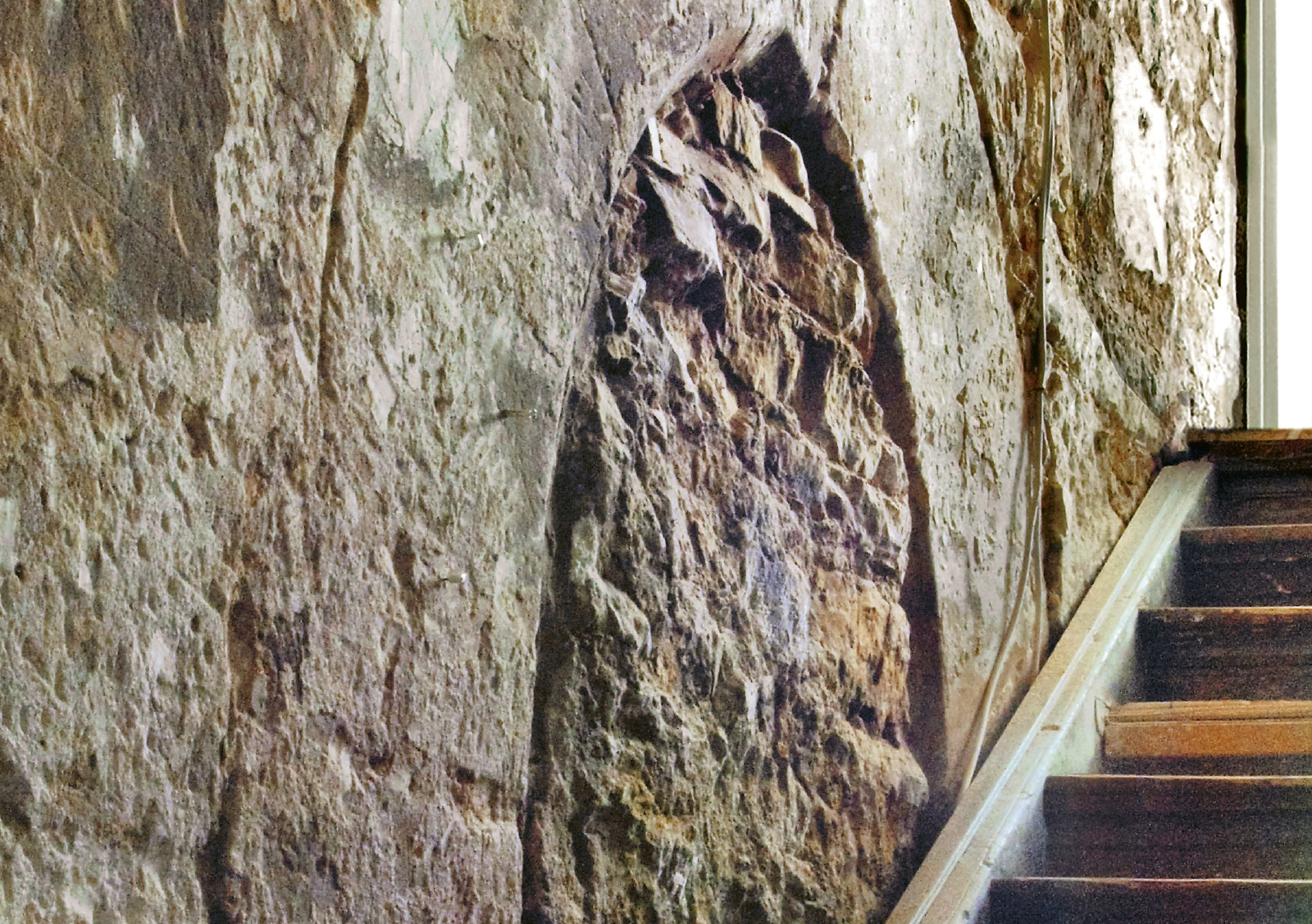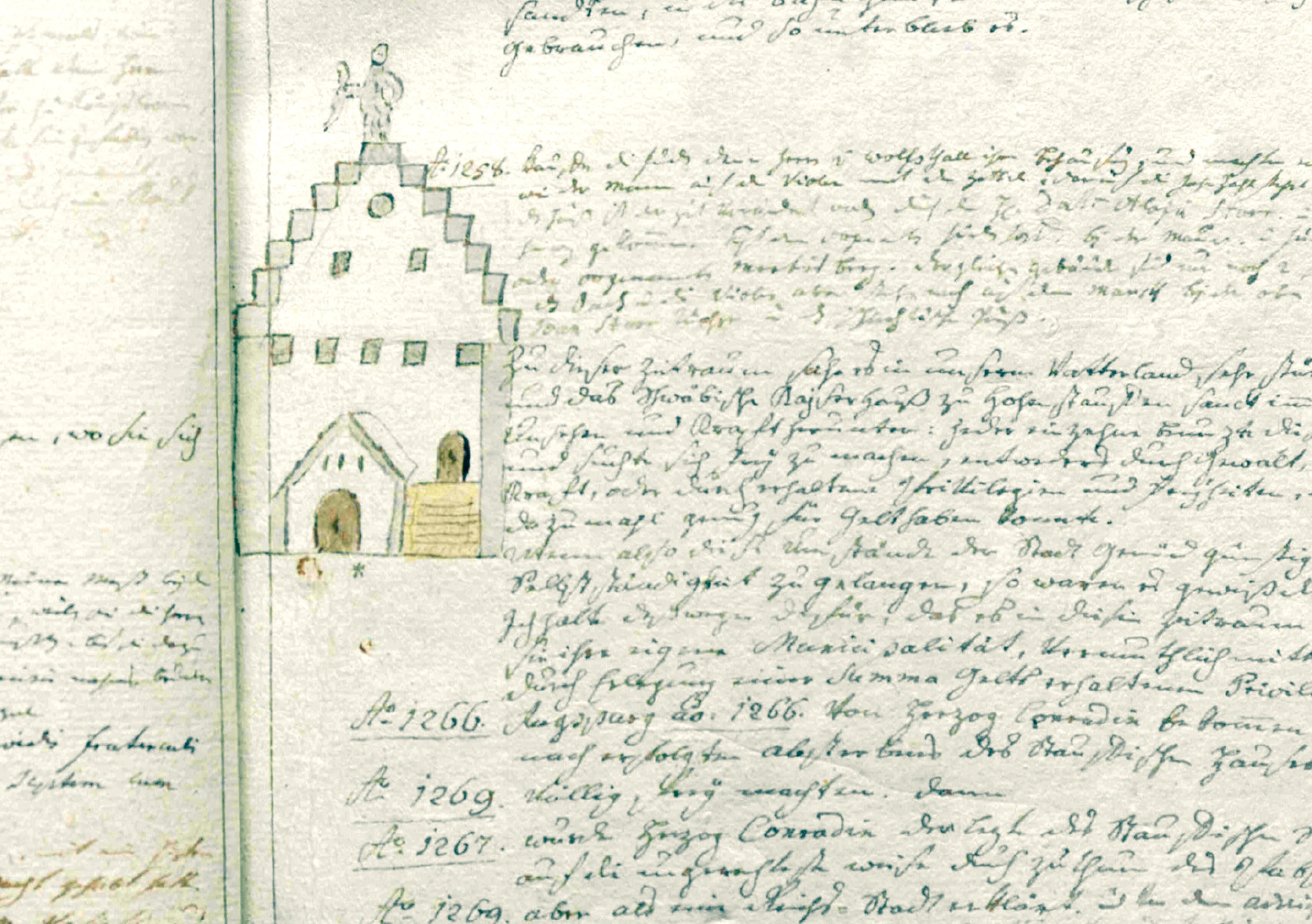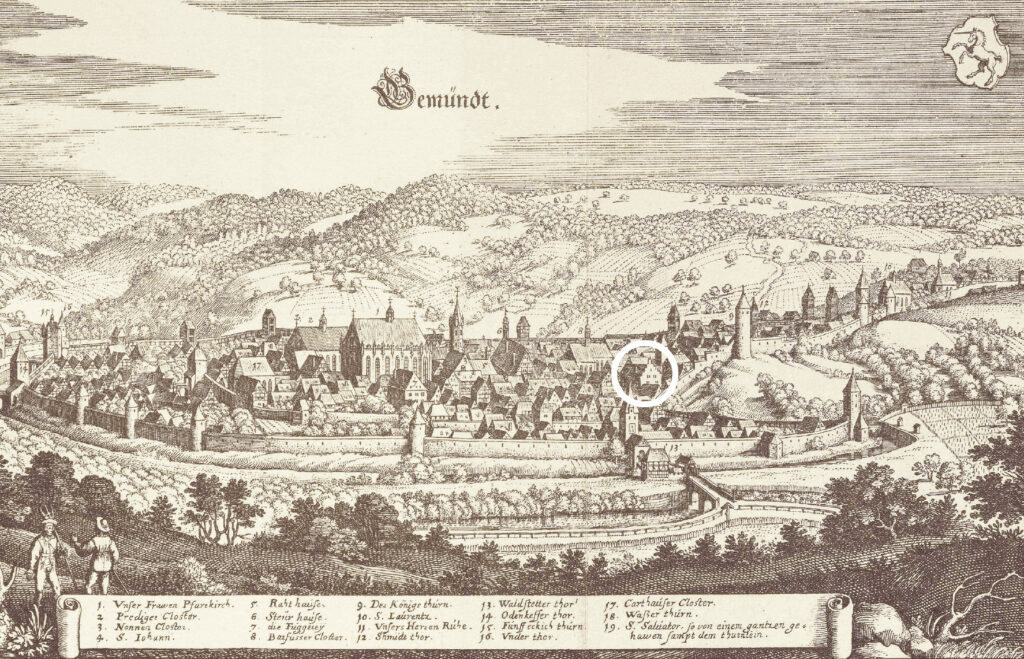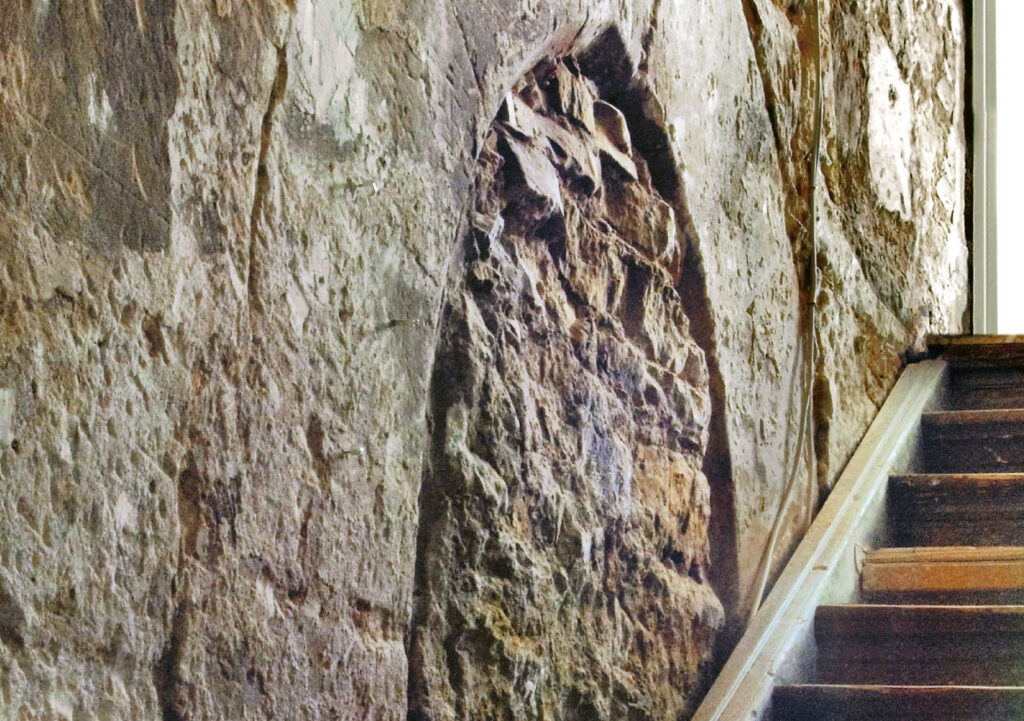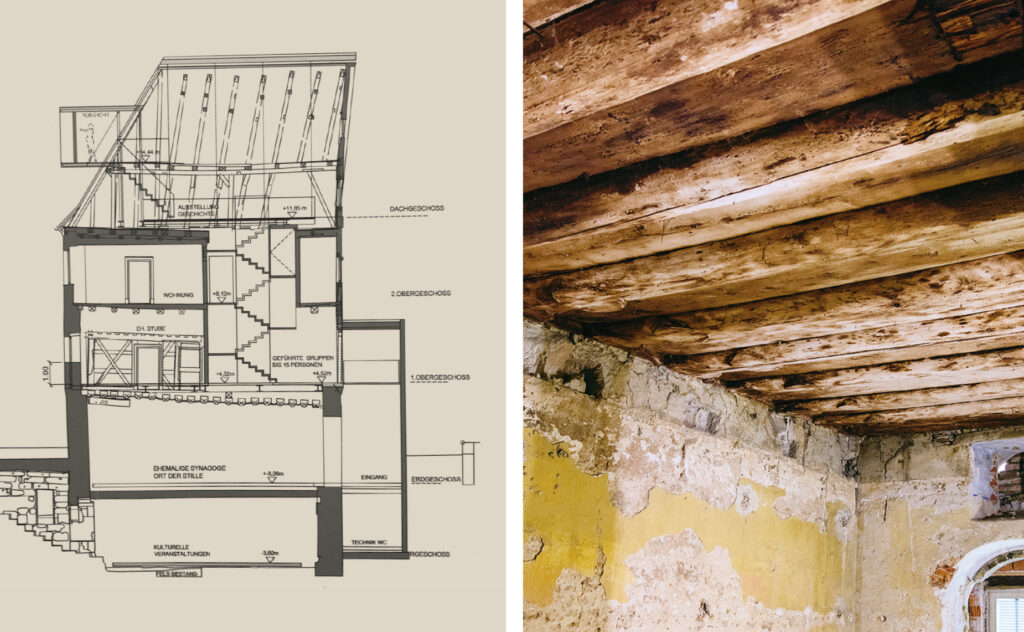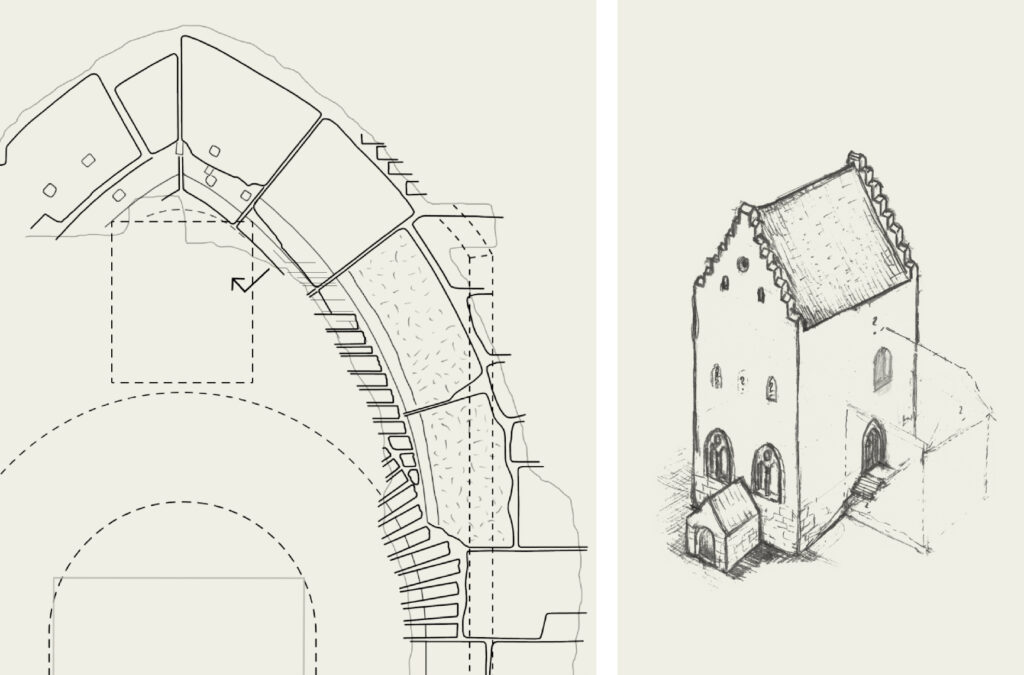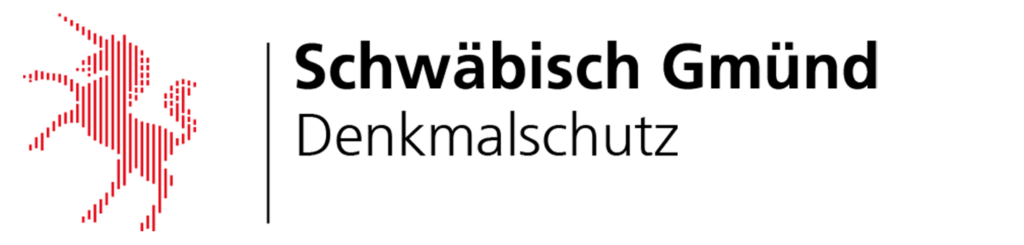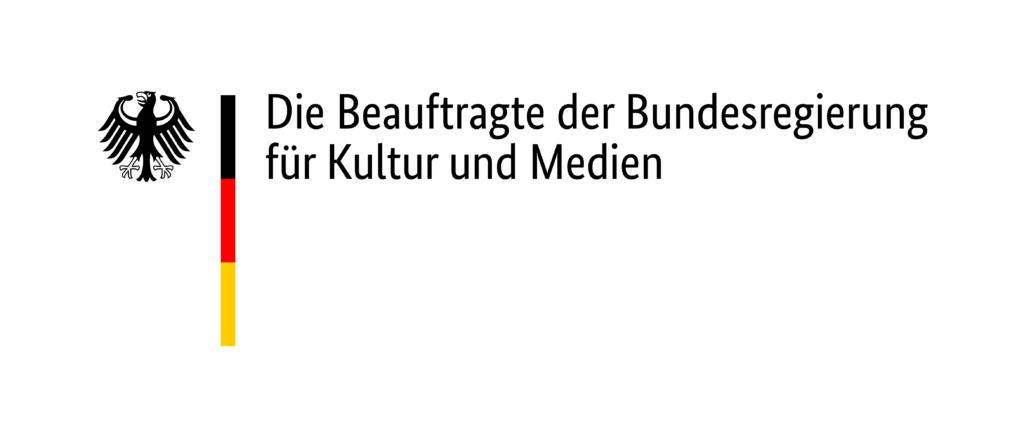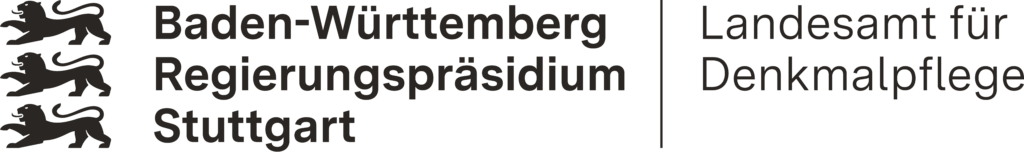Informationen für
Spenderinnen und Spender
Weltweit bedeutende Wiederentdeckung:
Jüdische Synagoge aus dem 13. Jahrhundert in Schwäbisch Gmünd
DOMUS JUDAEORUM
Einzigartig: Vollständig erhaltene, multifunktional genutzte Synagoge abseits der großen Zentren
Die in Schwäbisch Gmünd wiederentdeckte DOMUS JUDAEORUM ist deutschlandweit neben Erfurt das einzige authentisch erhaltene mittelalterliche Synagogengebäude.
Von den Sakralbauten der bedeutenden jüdischen Zentren und UNESCO-Kulturerbestätten Speyer, Worms und Mainz aus dem 11. und 12. Jahrhundert und in Köln und Marburg sind nur noch Reste oder Rekonstruktionen erhalten.
Während Speyer, Worms, Mainz und Erfurt über mehrere Gebäude für spezielle Zwecke (Synagoge für Männer, Synagoge für Frauen, Jeschiwa – Schule für Lernen und Lehren, Tanz und Versammlung) verfügten, geschah in der Imhofstraße in Schwäbisch Gmünd alles unter einem Dach – Gottesdienste, Tanzveranstaltungen, Lehren und Lernen.
Alleinstellende Besonderheit der DOMUS JUDAEORUM in Gmünd ist, dass sie die einzige in Deutschland vom Keller bis zum Dachstuhl von 1288 vollständig erhaltene, multifunktional genutzte Synagoge abseits der großen Zentren ist.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, dieses einzigartige Denkmal zu erhalten!
Die seit dem 13. Jahrhundert als jüdische Synagoge genutzte DOMUS JUDAEORUM (lat.: Haus der Juden) in Schwäbisch Gmünd ist in dieser Form und Funktion einzigartig in Deutschland.
Das Haus steht für die menschliche Fähigkeit, jenseits religiöser Überzeugungen zusammenzuleben – und zugleich für die Zerbrechlichkeit einer Gemeinschaft.
Als Stein gewordenes Zeichen für den Zusammenhalt ist es von hoher Bedeutung, dass dieses in Mitteleuropa einzigartige Denkmal erhalten, restauriert und behutsam neu genutzt werden kann.
Bitte unterstützen Sie uns dabei – stärken Sie dieses wichtige Anliegen mit Ihrer Spende!
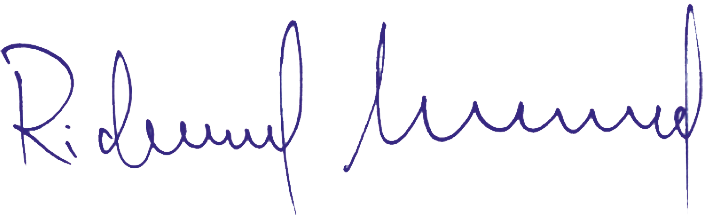
Richard Arnold, Oberbürgermeister Stadt Schwäbisch Gmünd
Kosten, Finanzierung, Spendenbedarf
Neben Mitteln der Stadt tragen Bund, Land, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Denkmalstiftung BW Fördermitteln für den Bauabschnitt 1 (Statische Sicherung) bei.
Für die Bauabschnitte 2 und 3 (Sanierung, Umbau, Umsetzung Nutzungskonzept) werden weitere Förderanträge bei geeigneten Programmen von Bund und Land gestellt.
Ergänzend sind jedoch auch weltweit Drittmittel und Spenden gefragt.
Baukosten
gesamt ca. 7 Mio Euro
Finanzierung
gesicherte Eigen- und Fördermittel
Bauabschnitt 1
ca. 2,1 Mio Euro
Förder- und Spendenbedarf
gesamt ca. 4,9 Mio Euro
Stand 03/2025
Ihre Spende fördert:
- Erhalt und Restaurierung eines im mitteleuropäischen Raum einzigartigen Denkmals jüdisch-christlicher Stadtkultur im Mittelalter
- Schaffung eines Begegnungsortes im Zeichen eines selbstverständlichen Miteinanders in religiöser und kultureller Vielfalt
- Sanierung durch den für seine Revitalisierungen historischer Bausubstanz mehrfach ausgezeichneten Südtiroler Architekten Werner Tscholl
- Nutzung für alle Generationen lokaler, überregionaler und internationaler Bildungsinteressenten

»Im Laufe der durch die Stiftung Heiligenbruck finanzierten Untersuchungen zeigte sich, dass es sich bei dem Gebäude um die Jahrhunderte lang vergessene, mittelalterliche Synagoge mit Dachwerk von 1288 handelt.«
Robert Dinser
Stiftung Heiligenbruck
Altes bleibt alt, Neues wird neu – Architekt Werner Tscholl revitalisiert die DOMUS JUDAEORUM
Der durch seine spektakuläre Zusammenarbeit mit Reinhold Messner (Museum Schloss Sigmundskron, Bozen) international bekannt gewordene Architekt Werner Tscholl plant die DOMUS JUDAEORUM-Sanierung.
Tscholls respektvoller Umgang mit historischen Bauten und gewachsenen Umgebungen führte zur Auszeichnung »Premio Architetto Italiano« des Jahres 2016. In der Begründung hieß es, er habe in seinen »Revitalisierungen« eine stilprägende Architektursprache entwickelt, »die die Kultur und die Geschichte der jeweiligen Orte hervorhebt«.
Entsprechend soll die im Mittelalter an der höchsten Stelle der historischen Stauferstadt gebaute DOMUS JUDAEORUM in der Gmünder Imhofstraße 9 restauriert werden, ohne sie wesentlich in ihrer Substanz anzutasten.

»Klar ist schon jetzt die ganz besondere Stellung der DOMUS JUDAEORUM im gesamten mitteleuropäischen Raum.«
Werner Tscholl
Planender Architekt Revitalisierung
DOMUS JUDAEORUM
Bauabschnitt 1:
Stabilisierung des Bestandsgebäudes
Durch die im Lauf der Jahrhunderte getätigten Umbauten (unter anderem die Abwalmung des Daches, Einbau neuer Decken in unterschiedlichen Höhenlagen, Einbau Treppenhaus, Einbau von Wohnungen mit Trennwänden) verlagerte sich die Lastabtragung ins Gebäudeinnere des Hauses. Dadurch sind die Decken überlastet, das Mauerwerk der Umfassungswände muss Zugkräfte aufnehmen, für die es nicht geeignet ist, und bricht auf. Insofern müssen in einem ersten Bauabschnitt die Umfassungswände gestärkt, die Decken ertüchtigt und das Dach stabilisiert werden.
Baubegleitend werden jahrhundertealte Putz- und Malschichten und die verschiedenen Fassungs-Befunde restauratorisch konserviert und gesichert.
Werner Tscholl
- Geboren 1955 in Latsch, Südtirol
- Architekturstudium in Florenz
- Neubauten und Revitalisierungen im privaten und öffentlichen Bereich (z. B. Schloss Sigmundskron – Messner Mountain Museum für Reinhold Messner)
- Mehrmalige Teilnahme Architekturbiennale Venedig
- Nationale und internationale Ausstellungen, Auszeichnungen und Publikationen
- Lebt und arbeitet in Morter, Vinschgau
Bauabschnitt 2 und 3:
Revitalisierung nach den Plänen von Werner Tscholl
Die Planung Werner Tscholls sieht vor, die notwendigen Erschließungen und An- und Einbauten mit den die Bausubstanz kontrastierenden Materialien Stahl und Glas zu realisieren.
Die Eingriffe erfolgen konsequent additiv, mit Respekt vor dem Bestand und sind zu einem späteren Zeitpunkt eindeutig der Umbauphase im 21. Jahrhundert zuordenbar. Der Bestand, wie er sich zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, bleibt erhalten.
Mit der Architektur von Werner Tscholl erhält die DOMUS JUDAEORUM ihre monumentale Anmutung zurück.
Projektplan Sanierung und Revitalisierung
2016
Stiftung Heiligenbruck übernimmt von Robert Dinser das Gebäude und stellt den Bauantrag in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt
2017
Baugenehmigung, Werkplanung, Beantragung Fördermittel
2018
Erwerb durch die Stadt Schwäbisch Gmünd
2019
Ergänzung der statischen Notsicherung
2024 Bauabschnitt 1A:
Statische Sicherung Umfassungswände
2025/2026 Bauabschnitt 1B:
Statische Ertüchtigung Decken und Dach
2026 Bauabschnitt 2:
Neubau Erschließungsgebäude, Umsetzung Nutzungskonzept
2027 Bauabschnitt 3:
Ausbau Bestandsgebäude, Umsetzung Nutzungskonzept
Modernes und zukunftsweisendes Nutzungskonzept
Neben einer Dauerausstellung zur vormodernen jüdischen Geschichte der Region Ostalb sind in Kooperation mit dem Jüdischen Bildungszentrum Württemberg Nutzungen vorgesehen wie z. B. Wechselausstellungen und Veranstaltungen zu den Themen Judentum, Interkulturalität und interreligiöser Dialog.
Nutzungskonzept
Gewölbekeller:
kulturelle Veranstaltungen (Platz für bis zu 30 Personen)
Erdgeschoss:
Ort der Begegnung
(Platz für bis zu 50 Personen)
1. Obergeschoss:
Raum für wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten und
Ausstellungen
2. Obergeschoss:
Begegnungs- und Arbeitsräume Jüdisches Bildungszentrum Württemberg
Dachgeschoss:
Dauerausstellung Jüdische Geschichte ab dem Mittelalter (Raum für bis zu 15 Besucher)
Geschichte des jüdisch-christlichen Miteinanders in Schwäbisch Gmünd
Um 1200 siedelten die staufischen Stadtherren in Gmünd wie auch in anderen Städten gezielt jüdische Kaufleute und Geldverleiher an, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.
Gmünd erlaubt den Bau der jüdischen Synagoge – der jetzt wiederentdeckten DOMUS JUDAEORUM – auf einem ihrer besten Grundstücke: am höchstgelegenen Punkt innerhalb des ummauerten Stadtkerns, direkt an der Stadtmauer.
Das 23 Meter hohe Steinhaus erzählt eine uns heute faszinierende Geschichte der Interkulturalität und einer funktionierenden jüdisch-christlichen Stadtkultur.
Um 1200
Errichtung eines Steinhauses am südöstlichen Rand der Stauferstadt
1241
Erste Erwähnung der Juden in Gmünd lässt auf eine größere Gemeinde schließen
1288
Errichtung Dachstuhl des auch als Synagoge genutzten Gebäudes
1501
Endgültige Vertreibung der Juden aus Schwäbisch Gmünd
2014
Nach 500 Jahren Nutzung als Wohnhaus: Wiederentdeckung der mittelalterlichen Funktion als Gemeindehaus der Juden
2018
Erwerb durch die Stadt Schwäbisch Gmünd
2027
Geplante Eröffnung als
Museum und Begegnungsort
Häufig gestellte Fragen
Was bewirkt meine Spende?
Die DOMUS JUDAEORUM steht für eine der weltweit wenigen erhaltenen Referenzen jüdisch-christlicher Stadtkultur im Mittelalter und hat insofern eine einzigartige Bedeutung weit über Schwäbisch Gmünd hinaus.
Spenden helfen, die durch die Beiträge der Stadt, verschiedener Stiftungen, aus Mitteln des Landes und des Bundes nicht ausreichend gedeckten Kosten für die Sanierung und Restaurierung des Gebäudes aufzubringen und so einen attraktiven, touristischen Anziehungspunkt Gmünds und Nutzungsangebote für die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Anhand des einzigartigen Beispiels der DOMUS JUDAEORUM kann gezeigt werden, wie eine vielfältige Stadtgesellschaft funktioniert hat und was sie gefährdet.
Wieso finanziert die Stadt die Sanierung nicht komplett?
Der Bedarf, der wegen des Alters des Gebäudes dringlich gedeckt werden muss, übersteigt vor allem auch wegen der Kurzfristigkeit die Möglichkeiten des städtischen Haushalts. Die Stadt setzt deshalb auf den Gemeinsinn, die Großzügigkeit der Bürgerinnen und Bürger und eine internationale Identifikation mit dem weltweit bedeutsamen Projekt.
Weshalb ist die Sanierung so aufwändig?
Die restauratorischen und technischen Herausforderungen, die das vielfach umgebaute und in den vergangenen Jahren lange leerstehende, rund 800 Jahre alte Gebäude stellt, können nur Schritt für Schritt und von ausgewiesenen Spezialisten bewältigt werden.
Warum hat es von der Entdeckung bis zum Sanierungsbeginn des Gebäudes so lange gedauert?
Das 2014 ursprünglich als Wohnbau-Vorhaben im denkmalgeschützten Rahmen geplante Projekt entpuppte sich über eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen mehr und mehr als eine historische Entdeckung, deren Bedeutung sich in einem europaweiten, ja weltweiten Zusammenhang erschließt. Dieser Prozess brauchte und braucht seine Zeit.
Wissenschaftlicher Beirat
Sandra Bosch M.A.
Untere Denkmalschutzbehörde
Stadt Schwäbisch Gmünd
Prof. Dr. Michael Goer
Landeskonservator a.D.
Baden-Württemberg
Prof. Dr. Johannes Heil
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
Dr. Gabriele Holthuis
Kunst- und Kulturhistorikerin
Dr. Niklas Konzen
Leiter Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd
Dipl. Ing. Markus Numberger
Büro für Bauforschung und Denkmalschutz, Esslingen
PD Dr.-Ing. Simon Paulus
Institut für Architekturgeschichte
Universität Stuttgart
Prof. Dr. Maria Magdalena Rückert
Landesarchiv BW,
Staatsarchiv Ludwigsburg
Dr. David Schnur
Stellvertretender Leiter
des Saarländischen Landesarchivs
Cornelia Stegmaier
Restauratorin
Dr. Maria Stürzebecher
Kuratorin Alte Synagoge Erfurt

»Die DOMUS JUDAEORUM gibt uns eines der weltweit ganz wenigen erhaltenen Zeugnisse einer mittelalterlichen jüdisch-christlichen Stadtgemeinschaft.«
Simon Paulus
Institut für Architekturgeschichte
Universität Stuttgart
Spendenkonto und Kontakt
DOMUS JUDAEORUM e.V.
Spendenkonto Kreissparkasse Ostalb
IBAN DE80 6145 0050 1001 4290 67
BIC OASPDE6AXXX
Spendenquittung
Gerne erhalten Sie eine Spendenquittung.
Bitte vermerken Sie Ihre Adresse auf dem Überweisungsträger.

Kontakt
Christian Baron
Erster Bürgermeister
Stadt Schwäbisch Gmünd
Marktplatz 37
73525 Schwäbisch Gmünd